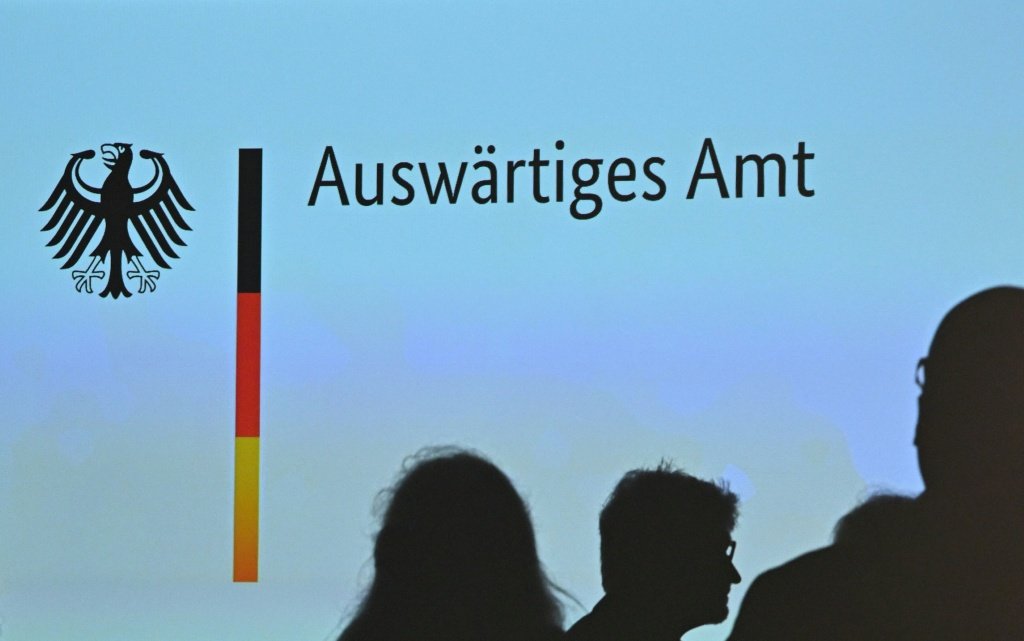Die Umstrukturierung des Auswärtigen Amtes markiert einen der deutlichsten Reformschritte deutscher Außenpolitik seit Jahren. Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) will das Ministerium neu ausrichten – weg von gewachsenen Strukturen, hin zu einer klaren Priorisierung deutscher und europäischer sicherheits- und außenpolitischer Interessen. Der Zeitpunkt ist kein Zufall: globale Machtverschiebungen, geopolitische Konflikte, technologische Umbrüche und wirtschaftliche Abhängigkeiten verlangen mehr strategische Handlungsfähigkeit als jemals zuvor.
Aus dem Ministerium heißt es, es gehe um nicht weniger als die Sicherung von „Sicherheit, Freiheit und Wohlstand“ in einer extrem volatilen Welt. Damit verbunden ist ein deutlicher Anspruch: Deutschlands Außenpolitik soll künftig mutiger priorisieren, sicherheits- und wirtschaftspolitische Interessen klarer definieren und Instrumente gezielter einsetzen. Der Reformansatz folgt damit einer Linie, die im internationalen Vergleich längst Standard ist – in Berlin jedoch immer wieder an internen Reibungen gescheitert war.
Kern der Neuausrichtung sind vier neu zugeschnittene regionale Abteilungen: Europa, Amerika, Asien/Pazifik sowie Naher und Mittlerer Osten/Afrika. Die Bündelung folgt der Logik geopolitischer Schwerpunkte und soll deutlich schnellere Entscheidungswege ermöglichen. Parallel dazu entsteht eine neue Abteilung für Sicherheitspolitik, die zentrale Bereiche wie Abrüstung, Rüstungsexportkontrolle und Cyber-Sicherheit zusammenführt – ein Schritt, der die sicherheitspolitischen Instrumente Deutschlands deutlich straffer organisieren dürfte.
Eine weitere Schlüsselrolle erhält die Abteilung „EU-Politik und Geoökonomie“, die wirtschaftliche, energiepolitische und außenpolitische Kompetenzen enger verzahnt. Dies spiegelt die Realität moderner Machtpolitik: Handel, Energie, Technologie und Sicherheit lassen sich längst nicht mehr getrennt betrachten. Wer das nicht zusammen denkt, verliert Handlungsspielraum.
Die neue Abteilung für Internationale Ordnung führt Aufgaben rund um UNO, Menschenrechte, Stabilisierung und humanitäre Hilfe zusammen – ein organisatorischer Schritt, der das internationale Engagement Deutschlands kohärenter machen soll. Gleichzeitig soll die Rechtsabteilung künftig gezielt Fachkräfteanwerbung im Ausland und die Stärkung der deutschen Wirtschaft unterstützen – ein Thema, das in Zeiten des Fachkräftemangels zunehmend außenpolitische Relevanz gewinnt.
Der Modernisierungsschub betrifft auch interne Strukturen: Künstliche Intelligenz, Digitalisierung und IT-Modernisierung sollen fest in den Arbeitsalltag integriert werden. Dass diese Neuausrichtung zugleich Teil der geplanten Einsparungen der Bundesregierung ist – mindestens acht Prozent Personalabbau bis 2029 –, macht die Aufgabe nicht einfacher. Dennoch soll das weltweite Netz der Auslandsvertretungen bestehen bleiben und gezielt an wichtigen Standorten verstärkt werden.
Die Umsetzung der Reform soll bis Sommer nächsten Jahres abgeschlossen sein. Klar ist: Wadephuls Umbau ist mehr als eine Strukturkosmetik – er ist ein Versuch, deutsche Außenpolitik auf ein neues, robustes Fundament zu stellen. Ob der Schritt die notwendige Schlagkraft bringt, wird sich an künftigen Krisen messen lassen müssen.
OZD
Alle Angaben ohne Gewähr.
Bild: AFP